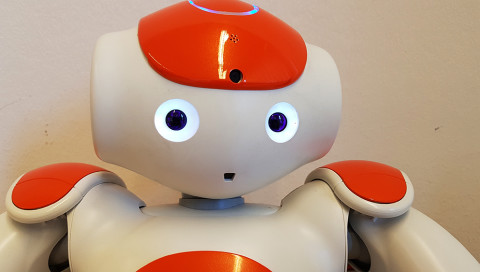Er sieht aus wie ein Hund mit Schlangenkopf. Oder eine Kreuzung aus Hund und Brontosaurier. Er kann besser tanzen als die meisten Menschen. Und er ist ein YouTube-Star. Der SpotMini von Boston Dynamics ist der zurzeit wahrscheinlich prominenteste Roboter der Welt. Doch nicht alle sind von seinen Fähigkeiten begeistert. Unter ein Video, in dem Spot scheinbar fröhlich herumhüpft und sogar moonwalkt, schrieb ein User: „Wenn du dann blutend am Boden liegst, wird das das letzte sein, was du siehst – bevor er dich umbringt.“ Ein anderer Nutzer brachte dann gleich noch den Terminator ins Spiel.
Wegen genau dieser Art von Reaktionen ärgert sich die Psychologin Leila Takayama, die an der Universität von Kalifornien die Interaktion zwischen Menschen und Robotern erforscht, über die fast schon gruseligen Internet-Videos. „Wir erzeugen mit solchen YouTube-Videos viel zu hohe Erwartungen an Roboter“, sagt sie bei der Falling-Walls-Konferenz in Berlin. „Denn wir zeigen nicht die vielen vorhergegangenen Versuche, die schief gelaufen sind.“ Auch die Menschen hinter den Robotern seien meistens nicht zu sehen.
Wenn SpotMini seine Tanzeinlage aufführt, ist zwar ein Teil seiner Bewegungen autonom. „Aber da ist immer auch noch ein Kerl mit einem Laptop, der SpotMini sagt, was er wann tun soll“, erklärt Takayama. Der Mensch gibt der Maschine die Richtung vor, seine Beine koordiniert der Roboter selbst.
Vom Terminator sind wir noch viele Jahre entfernt
Noch vor ein paar Jahren brauchten Entwickler viele Monate, um Robotern vermeintlich einfache Dinge beizubringen. Und selbst dann schafften es Prototypen nicht immer, eine Tür zu öffnen. Inzwischen hat die Robotik zwar Fortschritte gemacht. Aber von Science-Fiction-Vorstellungen wie dem tödlichen T-800 aus den Terminator-Filmen oder den alleskönnenden Haushaltsrobotern sind wir noch viele, viele Jahre entfernt. „Einen Roboter dazu zu bringen, das Schlafzimmer aufzuräumen, ohne dabei die Lego-Konstruktionen auf dem Teppich kaputtzumachen“, sagt Takayama zu WIRED, „das ist wie der Heilige Gral der Robotik.“
Trotz aller Durchbrüche in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz fehlt Maschinen der gesunde Menschenverstand, den sie bräuchten, um mit der echten Welt zu interagieren, sagt die Psychologin. Genau deshalb sind die meisten Roboter bisher in Käfigen in Fabrikhallen untergebracht. Bei den wenigen, die es schon in unsere Haushalte geschafft haben, müssen ihre Besitzer meistens helfend eingreifen. Sonst würden sie scheitern. „Schauen wir uns zum Beispiel die Staubsauger-Roboter an“, sagt Takayama. „Jeder behauptet, dass seiner perfekt funktioniert. Aber wenn man nachfragt, erfährt man, dass die meisten Leute herumliegendes Spielzeug oder Klamotten wegräumen oder die Teppiche anders hinlegen, bevor sie den Roboter anschalten.“
Bis auf Weiteres werden Roboter also unserer Hilfe brauchen. Daher glaubt Leila Takayama auch nicht, dass wir Menschen eines Tages aufwachen und Roboter plötzlich all unsere Jobs übernommen haben. „Ich gehe eher davon aus, dass es ein Beruf wird, Robotern zu helfen“, sagt sie. Einen Namen für diesen Job gibt es übrigens schon: Die Menschen, die am Laptop sitzen, wenn die Maschinen ihren Einsatz haben, werden Robot Wrangler genannt. Manche Roboter können sogar mehrere davon gebrauchen, zum Beispiel Forschungsroboter, die in die Tiefsee geschickt werden. Drei Vollzeitkräfte sind nur mit ihrer Steuerung beschäftigt, noch mehr menschliche Arbeit fällt durch Wartung und Weiterentwicklung an.
Roboter brauchen soziale Kompetenzen
Sollen Roboter in Zukunft mehr Aufgaben erledigen, die für Menschen zu anstrengend, gesundheitsgefährdend oder gar lebensbedrohlich sind, dann könnten Robotik-Experten knapp werden, die diese steuern können. Wie ließe sich dieses Problem lösen? Ganz einfach, erklärt die Psychologin Takayama. „Die Roboter brauchen soziale Kompetenzen.“ Ein Beispiel: Roboter, die scheitern oder Erfolg haben, sollten das aus ihrer Sicht durch Mimik oder Gestik zeigen. „Dann kann jeder verstehen, was der Roboter vorhat.“
Um Roboter für Menschen „lesbar“ zu machen, müssen sie aber nicht gleich wie Humanoide oder Hunde aussehen. Das bewies schon vor Jahren ein Versuch in New York. Die Künstlerin Kacie Kinzer schickte einen kleinen Papp-Roboter mit lächelndem Gesicht los, der nur eines konnte: geradeaus fahren. Dummerweise wollte er aber zu ganz bestimmten Adressen in Manhattan, die auf einer weißen Flagge an seinem Rücken notiert waren. Auch die Bitte um Hilfe stand darauf.
Tatsächlich unterstützen die Menschen die rollende Maschine bereitwillig. „Und das in einer Stadt, in der die Leute nicht gerade bekannt dafür sind, Augenkontakt zu suchen oder sich anzulächeln“, sagt Leila Takayama. „Doch einem kleinen Roboter halfen sie.“ Das sei einerseits ziemlich beeindruckend, sagt sie. Und obwohl sie für die gegenseitige Unterstützung von Menschen und Robotern eintritt, so sind die rollenden Papp-Maschinen für sie auch ein Beleg dafür, dass wir noch darüber diskutieren müssen, wie die Kooperation genau aussehen soll. Denn lächelnde Roboter könnten auch manipulativ sein. „Wir müssen anfangen darüber nachzudenken, was das bedeutet.“ Deshalb ist sie übrigens auch der Meinung, dass nicht nur Techniker und Ingenieure an Robotern forschen sollten, sondern sich auch Soziologen, Anthropologen, Psychologen oder Künstler damit beschäftigen.