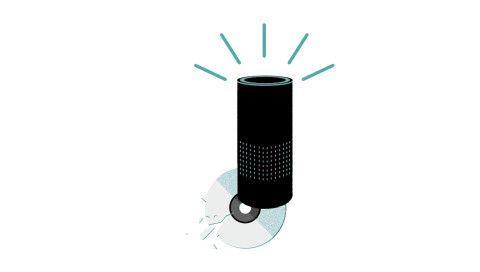An drei Abenden zeigte die Rechenmaschine, dass ihre Künstliche Intelligenz bei Rätselfragen nicht zu schlagen war: Fast 80.000 Dollar räumte IBMs Watson-System im Februar 2011 als Gewinner der amerikanischen TV-Quizshow Jeopardy ab. Der Schlüssel zum Erfolg lag in der blitzschnellen Auswertung des einstudierten Wissens, kombiniert mit treffsicherem Verständnis menschlicher Sprache – bis dahin beispiellos bei einem Computer. Anschließend aber wurde es still um den digitalen Champion: IBM fiel es schwer, praktische Anwendungen für das mächtige neue System zu finden.
Nach jahrelangem Experimentieren entschied sich das Unternehmen, Watsons Fähigkeiten als Sammlung von Cloud-Diensten anzubieten, die von Kunden individuell eingekauft werden können. Heute denkt Watson sich neue Kochrezepte aus, stellt Playlisten zusammen oder betätigt sich als Investmentberater. Besonders große Hoffnungen setzt IBM auf das Internet der Dinge (IoT), also die Vernetzung des Alltags: Wenn Milliarden Geräte Datenfluten produzieren, braucht es Systeme wie Watson, um darin Sinn zu finden, argumentiert das Unternehmen.
Als Standort für Watsons IoT-Zentrale wählte IBM München: Vor wenigen Tagen gab das Unternehmen bekannt, dort 200 Millionen Dollar zu investieren. Geleitet wird das Team von der Britin Harriet Green, zuvor Topmanagerin beim Reiseanbieter Thomas Cook. Green sprach mit WIRED über IBMs Pläne für Watson im vernetzten Alltag, die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt und den Schutz der Privatsphäre in Zeiten von Big Data.
WIRED: Frau Green, die meisten Menschen denken bei Watson wahrscheinlich immer noch an Jeopardy. Was hat Ihr System seitdem gelernt?
Harriet Green: Sehr, sehr viel. Mit Spielen hat Watson in Wahrheit wenig zu tun. Es geht um Cognitive Computing, wie wir es nennen: Künstliche Intelligenz mit Hilfe von maschinellem Lernen und natürlicher Spracherkennung. Das erlaubt es Watson, enorme Datenmengen zu verarbeiten, Zusammenhänge zu verstehen, daraus zu lernen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Mittlerweile bieten wir über 30 Services für Anwendungen aus unterschiedlichsten Branchen an – ganz einfach über die Cloud.
WIRED: Wie wird Watson konkret genutzt?
Green: Nehmen Sie die Medizin: Da haben wir Watson beigebracht, Tausende wissenschaftliche Aufsätze und medizinische Zeitschriften zu analysieren, um bei der Krebsforschung auf dem aktuellen Stand zu sein. Nun wird das System von führenden medizinischen Institutionen genutzt, wie dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center, der Universität von Texas MD Anderson Cancer Center und der Mayo Klinik. Generell gilt: Je mehr Daten Watson zur Verfügung hat, desto besser wird es. Deshalb liegt unser Fokus auch auf dem Internet der Dinge.
In den nächsten zehn Jahren wird ein Brontobyte an Daten anfallen
WIRED: Warum bauen Sie dafür in München eine eigene Zentrale auf?
Green: Weil im Internet der Dinge so gigantischen Datenmengen erzeugt werden – Milliarden intelligenter und vernetzter Sensoren in Geräten, Gebäuden, Autos, Fabriken. Diese Vernetzung führt schon jetzt dazu, dass die Menschheit allein in den vergangenen beiden Jahren mehr Informationen produziert hat als in der gesamten Geschichte zuvor. Das wird sich noch verstärken. In den nächsten zehn Jahren, so schätzen wir, wird ein Brontobyte an Daten anfallen.
WIRED: Ein Bronto…?
Green: Ja, ein Brontobyte. Aktuell produziert das Internet täglich ein Exabyte an Daten – so viel wie der Inhalt von 250 Millionen DVDs. Ein Brontobyte ist ein Vielfaches davon und entspricht etwa der Summe aller Sandkörner auf der Erde – multipliziert mit einer Milliarde. Um solche Massen an Daten zu bewältigen, brauchen wir Systeme wie Watson, die in der Lage sind, nicht nur aus strukturierten Daten zu lernen, wie man sie in einer Tabellenkalkulation findet, sondern auch aus unstrukturierten: Bildern, Filmen, Geräuschen, Gerüchen, Sensorinformationen aller Art.

WIRED: Welche Einsichten gewinnt Ihr System aus diesen Informationen?
Green: Eines der wesentlichen Anwendungsgebiete sind Smart Buildings. Sensoren, die in die Gebäudeinfrastruktur eingebaut wurden, liefern ständig Informationen über Dinge wie Temperatur, Energieverbrauch, Luftfeuchtigkeit. Watson kann daraus Schlüsse ziehen, zum Beispiel: „Dieser Teil des Gebäudes wird heute kaum genutzt, also brauchen wir dort nicht so viel Licht.“ Oder: „Basierend auf der Zahl an Menschen im Gebäude und Erfahrungswerten bei vergleichbarem Wetter sollte die Kantine die folgende Menge an Gerichten zubereiten, um kein Essen zu verschwenden“ So wird Watson zur Entscheidungshilfe für Gebäudemanager, die sofort auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren können.
WIRED: Künstliche Intelligenz ist plötzlich allgegenwärtig: Wie unterscheidet sich Watson von den mitdenkenden Algorithmen, die Google, Amazon oder Apple in ihre Geräte einbauen?
Green: Der größte Unterschied ist Watsons Reife. Wir haben bereits vor Jahren beschlossen, Watson-Dienste in der Cloud anzubieten. Heute gibt es mehr als 80.000 Entwickler weltweit, die diese Services nutzen, um neue Ideen in echte Anwendungen zu verwandeln. Und allein für Watson IoT zählen wir mittlerweile rund 6000 Kunden aus aller Welt. Dazu kommt Watsons Fähigkeit, natürliche Sprache zu verarbeiten – nicht nur in Englisch, sondern auch auf Französisch, Spanisch oder Japanisch etwa. Das System erkennt dabei nicht einfach nur Schlüsselwörter, sondern es ist in der Lage, sich durch Kontextanalyse den Sinn der Anfrage zu erschließen.
+++ Mehr zum Thema Künstliche Intelligenz gibt es in der WIRED-Herbstausgabe 2016 +++
WIRED: Andere Systeme können das nicht?
Green: Keiner unserer Konkurrenten hat eine vergleichbare Reife erreicht. Wir bieten Watson inzwischen für unterschiedlichste Bereiche an, darunter Bilderkennung, Übersetzung und – einer meiner persönlichen Favoriten – die Interpretation der Tonlage in menschlicher Kommunikation. Sie wissen sicher, dass Deutsche und Briten sich ganz unterschiedlich ausdrücken, ebenso wie Frauen und Männer. Mit Watsons Fähigkeit, Feinheiten zu verstehen, kann das System zum Beispiel in einer E-Mail automatisch erkennen, dass jemand emotional unter Stress steht und Hilfe braucht.
WIRED: Was wollen Sie mit Watson erreichen?
Green: Wir glauben, dass das Zeitalter der mitdenken Computer gerade erst beginnt. Ich werde bestürmt von Firmenchefs und Managern, die mir erzählen: „Wir haben all diese Daten. Was lässt sich daraus machen?“ Da können wir flexibel helfen. Die Beispiele reichen von der intelligenten Fabrik über das Auto, das mit dem Fahrer in natürlicher Sprache spricht, bis zur Waschmaschine, die ihren Energieverbrauch abhängig von der Auslastung optimiert.
WIRED: Sehen Sie die Gefahr, dass wir uns künftig zu sehr auf automatisierte Systeme verlassen?
Green: Nein, denn die Maschinen sollen uns ja nicht das Denken abnehmen oder uns ersetzen. Es geht um Systeme für Entscheidungshilfen, die die menschlichen Fähigkeiten erweitern können. Wie in den vorherigen industriellen Revolutionen werden langweilige, sich wiederholende und manchmal auch gefährliche Aufgaben von den Maschinen automatisiert. Berufe werden sich ohne Zweifel weiter verändern, aber die endgültige Entscheidung wird nach wie vor der Mensch treffen. Dazu kommt: Auch mitdenkende Systeme wie Watson können sich nicht einfach selbstständig eine neue Aufgabe suchen. Sie müssen von Menschen neu programmiert werden. Die Vorstellung, dass KI-Systeme irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen, ist also wirklich Material aus Science-Fiction-Filmen.
Jeder, der ein Smartphone nutzt, testet täglich die Grenzen der Privatsphäre
WIRED: Dennoch machen sich viele Menschen Sorgen, dass Maschinen zum Jobkiller werden. Schließlich übernehmen Roboter und Expertensysteme immer mehr Aufgaben, für die bisher eine gute Ausbildung und viele Fachkenntnisse nötig waren.
Green: Das muss nicht so kommen, wie die Geschichte zeigt. IBM ist jetzt 105 Jahre alt, und es gab häufig Widerstand gegen das Neue – automatische Nähmaschinen etwa hatten anfangs auch viele Gegner. Immer wieder haben wir tiefgreifenden Wandel gesehen, von Tabelliermaschinen über Großrechner hin zu PCs und Mobilgeräten. Solche Veränderungen verlangen, dass Menschen dazulernen, und Schulen müssen sich anpassen – aber Technologie schafft auch immer wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten.
WIRED: Allgemein betrachtet mag das stimmen, aber für die Betroffenen ist das ein geringer Trost, oder?
Green: Natürlich müssen Regierungen und Bildungssysteme sicherstellen, dass wir bereit sind für solche Veränderungen, indem sie uns mit dem nötigen Wissen ausstatten. Das war auch ein wichtiger Grund dafür, dass wir unsere weltweite Zentrale für Watsons IoT-Anwendungen in München angesiedelt haben: weil Deutschland fest an Industrie 4.0 glaubt und deutlich mehr Chancen als Nachteile sieht – selbst wenn der digitale Wandel von den Menschen verlangt, dass sie sich immer weiterbilden.
+++ Mehr von WIRED regelmäßig ins Postfach? Hier für den Newsletter anmelden +++
WIRED: Warum München? IBM Deutschland ist ja eigentlich in der Nähe von Stuttgart beheimatet.
Green: Verschiedene Faktoren waren hier entscheidend. In erster Linie war die Nähe zu unseren Kunden wichtig. Viele sind in oder um München stationiert, wie zum Beispiel BMW, Allianz und Schaeffler. Zudem gibt es eine hohe Konzentration an Talent: Münchens Universitäten, wissenschaftliche und technologische Forschung, die hohe Bildung und die Verfügbarkeit von Ingenieuren. Dazu kommt, dass München ein Verkehrsknotenpunkt ist, der sehr gut mit anderen Städten weltweit vernetzt ist. Auch die Unterstützung durch die Regierung war uns wichtig, die Stadt München und der Staat Bayern haben uns sehr willkommen geheißen. Das Resultat ist ein Investment von 200 Millionen Dollar über fünf Jahre hinweg – eine unserer größten Investitionen in Europa überhaupt, die mehr als 1000 neue Arbeitsplätze schafft.
WIRED: Der Schutz der Privatsphäre ist gerade in Deutschland ein Top-Thema. Was passiert mit all den Daten, die bei Ihnen zusammenlaufen?
Green: Zunächst einmal: Jeder, der ein Smartphone nutzt, testet täglich die Grenzen der Privatsphäre indem er große Mengen an persönlichen Daten produziert. Europa nimmt das Thema zum Glück sehr ernst und verteidigt den Schutz unserer Daten. Das deckt sich mit der Einstellung von IBM: Wir respektieren den Schutz der Privatsphäre, und wir nehmen Datensicherheit außerordentlich ernst. Entsprechend sind alle Informationen, die über die Watson IoT-Plattform laufen, verschlüsselt und entsprechen demselben Grad an Sicherheit wie unsere Softwarelösungen für über 90 Prozent der Banken weltweit, alle großen Flughäfen oder auch Luftfahrt-Kontrollsysteme, die IBM Systeme nutzen.