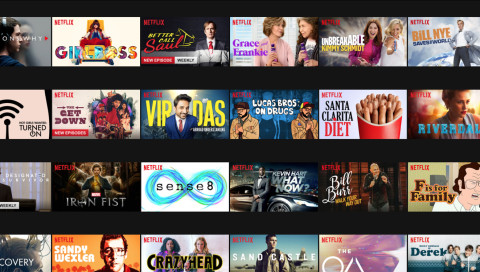ACHTUNG: Spoiler-Warnung! Dieser Artikel bespricht ausführlich zentrale Teile der Story von Episode VII.
Es ist unmöglich, sich von „Star Wars“ zu isolieren, denn es ist wirklich überall: im Happy Meal und bei Lego, auf Sammelbechern und Ringblöcken oder beim Scrollen durch 9GAG. Karneval, Halloween, Geburtstage, Hochzeiten und Beerdigungen — vermutlich gibt es kein Ereignis des menschlichen Daseins, das nicht schon einmal in einer „Star Wars“-Version stattgefunden hat. Selbst Haustiere wissen, was „Star Wars“ ist.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal mit „Star Wars“ in Berührung kam, als ich eine McDonalds Juniortüte in den Händen hielt. Darin war ein Spielzeug: ein kleines, graues Raumschiff mit einer klebrigen Rolle auf der Unterseite, um an Wänden oder Schränken langsam herunterzutuckern. Diese Rolle überzog sich jedoch schnell mit einem ekligen Film aus Fusseln und Haaren. Nachdem ich „Das Erwachen der Macht“ nun gesehen habe, würde ich sagen, war dieses Raumschiff damals wohl ein Millenium Falcon. Ich hatte ja keine Ahnung.
In den kommenden Jahren sollte ich noch einiges über „Star Wars“ lernen: dass Darth Vader der Vater von irgendjemandem ist, dass laut einigen Sitcoms Prinzessin Leia wohl der feuchte Traum eines jeden pickeligen 70er-Jahre-Teenagers war, dass Chewbacca ein haariger Teen-Wolf ist, der nur bemitleidenswerte Sirenenrufe von sich geben kann. Und dass immer unerbittlich mit Lichtschwertern gekämpft wird.
Trotzdem wird der wichtigste Kampf des Films mit Neonröhren aus dem Partykeller des Elternhauses ausgetragen.
Lichtschwerter? What the...? Wahrscheinlich soll hier ein Gleichnis erfüllt werden. Ritter kämpfen nun einmal mit Schwertern und da es bei „Star Wars“ auch Ritter gibt, müssen die das eben auch. Währenddessen gibt es aber auch eine ganze Reihe an Handfeuerwaffen, die sehr viel effektiver und sogar aus der Ferne ihren Dienst erfüllen. Trotzdem wird der wichtigste Kampf des Films mit blauen oder roten Neonröhren aus dem Partykeller des Elternhauses ausgetragen. What the...?

Zugegeben: Ich bin kein Freund von Kampfszenen, Schießereien und Verfolgungsjagden. Sie langweilen mich, ich finde sie meistens vorhersehbar und unnötig in die Länge gezogen. Für mich sind sie nicht Teil der Handlung, sondern Lückenfüller. Und eigentlich ist ja nur wichtig, wer am Ende gewinnt und wer verliert.
Gibt es wirklich Menschen, die wie gebannt auf den Bildschirm starren und zuschauen, wie Ritter 1 einen Treffer auf der linken Schulter von Ritter 2 landet? Ist es wichtig, dass das Ritter-1-Pferd fast über einen zerbröckelten Pferdeapfel gestolpert wäre? Wer gewinnt und wer verliert, weiß man doch meistens relativ schnell.
Als jemand, der nun zum ersten Mal einen „Star Wars“-Film gesehen hat, aber über die Jahre immer wieder popkulturell kleine Häppchen gefüttert bekam, ist meine Meinung unverändert: Es gibt bestimmte Klischees, die sich mit „Star Wars“ entwickelt haben. Das ist wie mit Stephen King, der mit bestimmten Bildern das Horror-Genre prägte, unzählige Male kopiert wurde und am Ende mit seinen eigenen Klischees weiterarbeiten musste. Die von ihm geprägten Bilder wie der verrückte Axtmörder oder klaffende Fleischwunden, die als „vertikales Grinsen, aus dem Blut sickert“ beschrieben werden, tauchten in anderen Büchern und Filmen unzählige Male wieder auf. Und „Star Wars“ teilt dieses Leid. Das Leid, einmal zu den Vorreitern gehört zu haben und schlussendlich nur noch ein Klischee seiner selbst hervorbringen zu können.
Was hat Han Solo falsch gemacht, dass sein Sohn zum „Star Wars“-Hitler wurde?
Ein konkretes Beispiel: Eine Figur — Han Solo genannt —, die scheinbar schon im ersten Film mit dabei war, möchte den eigenen Sohn von der dunklen Seite zurückholen, denn er hat ja nicht ein komplett dunkles Herz. Sein Sohn hat sich aber mittlerweile zum Hauptmann der bösen Armee hochgearbeitet. Was macht Vater nun? Vater trifft sich mit Sohn auf einer Gitterbrücke über einem tiefen Abgrund und bittet ihn nach Hause zu kommen. Sohn vergießt Träne, bittet Vater um Hilfe. Vater möchte ihm das Laserschwert abnehmen, Sohn lässt nicht los. Und oh hoppla, der Sohn ist immer noch böse, obwohl sein Vater gerade zwei Sätze mit ihm gesprochen hat. Sohn stößt Vater daraufhin in den Abgrund.

Was sagt mir das über den Charakter des Vaters? Hat er in seinem Leben denn überhaupt nichts über Menschen gelernt? Und was bitte hat Han Solo in seiner Erziehung falsch gemacht, dass sein Sohn überhaupt Reißaus genommen hat und zum „Star Wars“-Hitler wurde? Selbst wenn ich den Hintergrund kennen würde, wäre diese Szene absurd. Sie stellt den Vater als naiven Vollidioten dar, dessen soziale Kompetenz und Erfahrung komplett in Frage gestellt werden. What the...?
Die „Star Wars“- Filmstruktur ist schon zu alt, als dass ich ihre Anfänge hätte miterleben können: Gut kämpft gegen Böse, Gut gewinnt noch im letzten Moment, aber ach nein, da kommt ja noch ein Teil! Und dann geht alles wieder von vorne los. Schaut man nur eine einzige Episode, versteht man nicht, was die beiden Lager teilt — weiß aber natürlich, auf wessen Seite man steht.
Selbst die musikalische Gefühlmanipulation funktioniert, auch ohne einen anderen „Star Wars“-Film gesehen zu haben: Han Solos Tod wird natürlich traurig untermalt. Gerade ist etwas dramatisches passiert, das lässt einen die Musik fühlen – egal, wie viele „Star Wars“-Filme man gesehen hat. Und der Film hat es nötig.

Wo sehr viel Handlung gebraucht wird, gibt es nun einmal dementsprechend schwächere, weniger ausgearbeitete Charaktere. Es muss die ganze Zeit sehr viel passieren, zwischenmenschliche Momente werden umso schneller abgehandelt. Was habe ich über die Figuren im Film erfahren, außer dass sie eben gut oder böse sind? Wenig.
Chewbaca ist ein einziger Running Gag ohne Handlungsfunktion.
Nun zu den Gags. Während Chewbacca in diesem Film ein einziger Running Gag ist, sind die anderen Witze eine durchgelaufene Schuhsohle. Zwei Figuren auf der Flucht: „Beruhig dich!“ — „Ich bin ruhig!“ — „Nein nein, ich rede mit mir selbst!“ Was ein Schenkelklopfer! Dieser Gag könnte aus jeder flachen Liebeskomödie mit Katherine Heigl und Seth Rogen stammen.
„Star Wars“ ist ein Film für Kenner, genau wie die Bücher von Stephen King. Die sind auch kein Zug, auf den man nachträglich aufspringen kann, damit ist man groß geworden – oder er ist eben abgefahren. So wird aus mir nun auch kein „Star Wars“-Fan mehr. Der einzige Grund noch eine Episode anzuschauen, wäre mein Interesse an den schlechten Special-Effects der ersten Filme. Der tiefere Sinn, die Entwicklung über die Jahre und die Faszination mit den Figuren – da bin ich raus.
Was mich allerdings am meisten an „Star Wars“ stört, ist nicht der Film, sondern der mediale Hype drumherum. Das Bohei hat ein Ausmaß angenommen, dem der Film niemals gerecht werden kann. Als Außenstehende bin ich zu Tode genervt und von diesem Rummel völlig abgestoßen. Mittlerweile bin ich überzeugt: Irgendwann werden all diese Fans enttäuscht sein, weil der Film niemals so viel hergeben kann wie der illusionsschaffende Hype.
Am Ende war „Star Wars“ für mich ein Film, über den ich im Grunde schon alles wusste. Dazu hätte ich eigentlich nichts ins Kino gehen müssen.