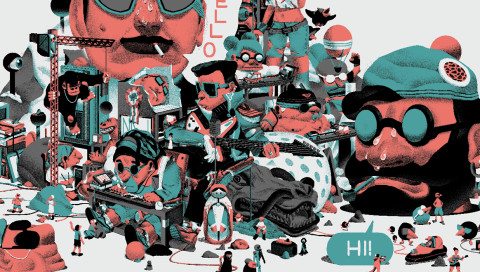Von 1967 bis 2005 wurden insgesamt 684 Episoden von Star Trek ausgestrahlt. Dazu kommen 22 halbstündige Folgen der Zeichentrickserie. Abzüglich der Werbepausen sind das knapp 521 Stunden. Zählt man die 13 Spielfilme hinzu – von Star Trek: The Motion Picture (1979) bis zu Star Trek: Beyond (2016) – dann ergibt das 48 Tage Star Trek am Stück. Ausgenommen davon sind die unzähligen Bücher und Comics.
Die Geschichte überspannt einen sehr viel längeren Zeitraum. Die Prequel-Serie Star Trek: Enterprise beginnt etwa im Jahr 2151. Nemesis beendet als letzter Film den Erzählstrang ungefähr 2379. Zieht man dann in Betracht, dass die Crew der Voyager einmal bis zum Anbeginn der Zeit zurückgeschickt wird und in The Next Generation es eine Episode gibt, die im Jahr 2395 spielt, bedeutet das, dass es insgesamt 14 Milliarden Jahre Star-Trek-Geschichte gibt.
Die drei neuen Reboot-Filme (Star Trek, Into Darkness und Beyond) bleiben dabei ausgeklammert. Sie spielen in einer alternativen Zeitlinie, die völlig losgelöst vom Original existiert. Vielleicht ist es aber auch falsch, sie deswegen nicht mitzuzählen, denn immerhin verbringen die meisten Star-Trek-Serien (abgesehen von Voyager und The Next Generation) mindestens eine Episode im Spiegeluniversum – einer Parallelwelt, in der die Charaktere ihre dunkelsten Seiten ausleben. Eigentlich gibt es also drei eigenständige Star-Trek-Universen.
Kurz gesagt: Es gibt wirklich viel Star Trek. Und mittlerweile ist ein erster Trailer der immer wieder verschobenen Serie Discovery veröffentlicht worden. Bald gibt es also 15 weitere Stunden, die den fiktiven Universen hinzugefügt werden.
In den USA wird Star Trek: Discovery zuerst auf dem Streaming-Portal CBS All Access zu sehen sein. Kein Anbieter, den besonders viele Trekkies abonniert hätten. CBS spekuliert aber wohl darauf, dass die Serie neue Kunden auf die Plattform zieht. In Deutschland ist der Release entspannter, Discovery wird einfach auf Netflix gezeigt.
Viele Fans haben jedoch Sorgen, wenn es um die neue Serie geht. Sie stellen Fragen wie: Warum hat sich der Starttermin so oft verschoben? Wieso wechselte Showrunner Bryan Fuller lieber zu American Gods? Und was hat es mit der hässlichen Schriftart auf sich, die im Trailer ständig eingeblendet wird? Es bleibt einem wohl nur, in bester Trekkie-Manier auf eine bessere Zukunft zu hoffen.
Star Trek hat schon immer als Serie überzeugt, nie als Kinofilm
Bisher hat Star Trek immer als Serie überzeugt, nie als Kinofilm. Das Fernesehen war immer die wahre „Final Frontier“. Discovery könnte sich deshalb als positive Überraschung erweisen – etwa im Vergleich zu den Reboot-Filmen.
Im Zentrum von Dicovery steht eine unerfahrene Sternenflotten-Offizierin (gespielt von Sonequa Martin-Green), kein erfahrener Captain. Letzteres bekommen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt zu sehen (gespielt von Michelle Yeoh). Die meist weißen, heterosexuellen Männer mit eingefallenen Wangen wurden zugunsten eines Teams ausgetauscht, dass die Vision von Star-Trek-Erfinder Gene Roddenberry besser repräsentiert, als jede bisherige Inkarnation der Serie. Mit einem neuen Raumschiff, einer neuen Besatzung und unendlichen Welten, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Beam uns hoch, Scotty!
Der Trailer hat die Ästhetik, die Lensflare-Effekte und die Kameraführung der Reboots von J.J. Abrams und Justin Lin. Das könnte zum Dorn im Auge all jener Fans werden, die sich Schauspieler wünschen, die hölzern stolpern, während durch das Schütteln der Kamera ein Angriff mit Photonen-Torpedos simuliert wird. Die hoffen, dass in langen Dialogen erklärt wird, warum die Schilde auf 30 Prozent gefallen sind und deshalb die Trägheitsdämpfer deaktiviert wurden.
Wenn Star Trek in das Korsett eines Hollywood-Streifens gequetscht wird, verwandelt es sich zwangsläufig in eine konventionelle Abenteuergeschichte mit Enthüllung im dritten Akt und einem Finale voller CGI und Explosionen. Das können sich die Zuschauer heute aber schon zu Genüge bei Star Wars oder Marvel holen. Dafür braucht niemand Star Trek. Eine TV-Show hat deshalb die Chance, mit weniger Budget und mehr Zeit die Serie zu ihren authentischen Wurzeln zurückzuführen.
Dass Star Trek als Serie immer in diesem Ausmaß funktioniert hat, lag zum großen Teil an der Hartnäckigkeit der Autoren. Wie bei vielen anderen Serien gab es kreative Krisen. Dann fingen die Schreiber aber an, mit Genres zu experimentieren, schrieben Komödien auf dem Holodeck oder orientierten sich an Horrorfilmen. Weil im Universum von Star Trek fast alles möglich war, konnten sie sich selbst persiflieren oder Charaktere für eine Episode verlieben lassen, ohne dass dies größere Folgen für das gesamte Narrativ hatte. Die Science-Fiction wurde so zu einem Werkzeug, statt zu einem Stereotyp.
Die Science-Fiction war immer ein Werkzeug, nie ein Stereotyp
Im Grunde handelt Star Trek stets von Amerikanern, die lernen, im Angesicht eines moralischen Dilemmas das Richtige zu tun. Die Bösen sind dabei eine Metapher ihrer Zeit. Die Klingonen standen für Russland während des Kalten Krieges, die Borg für den Stereotyp kollektivistisch denkender Asiaten und im Prequel Enterprise gab es schließlich Alien-Terroristen.
In jeder Serie geht es im Grunde darum, dass Menschen herausfinden, was es bedeutet, Mensch zu sein. Star Trek hat diese Frage mit seinen Charakteren stets neu interpretiert. Sei es mit dem Halb-Vulkanier Spock, dem Androiden Data, dem Gestaltwandler Odo, dem Computerprogramm Doktor oder der aus dem Borg-Kollektiv befreiten Seven Of Nine.
Die gute Nachricht für Discovery ist, dass die heutigen Muster guten Fernsehens genau denen von Star Trek folgen. In einzelnen Episoden machen die Charaktere eine Entwicklung durch, die sich gleichzeitig über ganze Staffeln spannen kann. So bekommen selbst die Bösewichte spätestens bis zum Staffelfinale Tiefgang. Im Original von 1967 geschah das eher unabsichtlich, heutzutage gehören Charakterentwicklung und sich eine über mehrere Episoden spannende Handlung zum Handwerkszeug nahezu jeder Serie.
Nach The Wire, Sopranos und Breaking Bad leben wir in einer Ära, in der Netflix und Amazon Prime im harten Wettbewerb um die besten Talente stehen. Die Frage ist nur, ob den Autoren von Discovery bewusst ist, dass sie nicht nur eine neue Serie erschaffen, sondern ihren Beitrag zu einem ganzen, schon existenten Universum leisten müssen. Einer kollektiven Geschichte, die gleichsam von ihren Fans und Autoren weitergeschrieben wird. Denn es braucht nicht nur Mut, eine neue Welt zu entdecken, die kein Mensch je zuvor gesehen hat, sondern auch, sie zu pflegen.