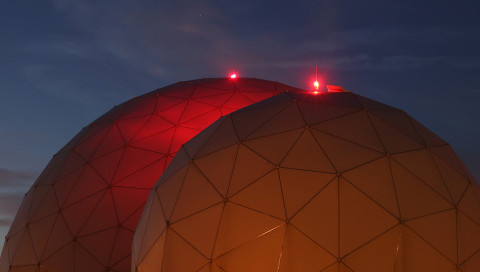Wer von Star Wars: Das Erwachen der Macht genervt war, weil er einfach eine Kopie von Episode IV ist, wird Rogue One: A Star Wars Story lieben. Der neueste Ableger der Saga zeichnet keine Heldenreise, keine Geschichte eines auserwählten Menschen, der Großes vollbringen wird. Sondern ist die Geschichte derjenigen Fußsoldaten, die das, was Luke Skywalker zu Ende brachte, überhaupt erst möglich machten – und die dafür bereit waren, ihr Leben zu geben.
Auch wenn Jyn Erso (Felicity Jones) im Zentrum steht, ist sie keine Heldin, die den Film komplett für sich einnimmt. Sie steht vielmehr prototypisch für die vielen Menschen und Außerirdischen, die vom Imperium unterjocht und in den Untergrund getrieben wurden.

Ihre traurige Verzweiflung, die Antriebskraft der Rebellion, zieht sich durch den gesamten Film. Keine heroische Spezialeinheit sind die Rebellen, sondern ein loser Zusammenschluss von Splittergruppen, die eben einen gemeinsamen Feind haben. Die einen sind die letzten Überreste des Militärs eines Planeten, der Widerstand leistet, die anderen hausen in Höhlen und verüben Guerilla-Attacken auf imperiale Patrouillen. Die Linie zwischen Terrorist und Freiheitskämpfer verschwimmt.
Rogue One flickt die größten Logikfehler von Episode IV
In Rogue One wird es zum ersten Mal deutlich, was es bedeutet, auf einem Planeten zu leben, der vom Imperium besetzt ist. Das einzige, was die Rebellion zusammenhält, ist die Hoffnung, der Glaube an eine bessere Zukunft. So bekommt der Titel des ersten Star-Wars-Films – Eine neue Hoffnung – durch sein Prequel eine tiefere Bedeutung. Es wird klar, wie viel einige Menschen bereit waren, für diese neue Hoffnung zu opfern.
Wofür viele Fans Rogue One lieben werden: Der Film flickt die größten Logikfehler in der Story von Episode IV. Wieso wurde der letzte Angriff auf den Todesstern mit einer lachhaft kleinen Staffel aus 30 Raumschiffen geflogen? Und warum hatte der Todesstern einen so zentralen Designfehler, dass er von Luke mit nichts als einem Protonentorpedo und einem Quäntchen Macht in die Luft gesprengt werden konnte? Rogue One beantwortet beides fast beiläufig, ohne dass es sich nachträglich aufgesetzt anfühlt.

Doch es gibt leider nicht nur Gutes zu sagen. Die größte Schwäche des Prequels ist, dass es 30 Jahre zu spät gedreht wurde – oder zehn Jahre zu früh. Weil viele Nebendarsteller der alten Filme entweder tot oder mittlerweile zu alt für ihre Rollen sind, wurden diese durch CGI und mithilfe anderer Schauspieler zu neuem Leben erweckt. Es ist beeindruckend, zu sehen, wie weit die Technologie auf diesem Gebiet gekommen ist, die digital wiederbelebten alten Bekannten aus Episode IV sehen ihren Vorbildern beeindruckend ähnlich. Die Filmindustrie steht offenbar kurz davor, tote Darsteller per CGI auferstehen lassen zu können, ohne das man es merkt – aber eben nur kurz davor.
Rogue One betritt viel zu oft das Uncanny Valley. Also jenen Moment, wenn eine Technologie gut genug ist, um einen Menschen fast fehlerfrei nachzubilden, aber viele kaum wahrnehmbare Details eben immer noch nicht ganz perfekt sind. Dann bricht die Illusion. Auch wenn man selbst nicht genau sagen kann warum.

Dieser Effekt tritt bei Rogue One vor allem dann ein, wenn man begeisterter Star-Wars-Fan ist und die alten Episoden mit all ihren Details in unzähligen Filmnächsten aufgesogen hat. Neue Zuschauer werden vielleicht gar nicht bemerken, dass ein Charakter bereits einen Auftritt in Episode IV hatte und jetzt per CGI einen kurzen Cameo in Rogue One bekommt. Doch für viele Hardcore-Fans werden sich diese Momente einfach seltsam anfühlen. Zum Beispiel bei einem der zentralen Charaktere des Films (wir verraten nicht, wer): Jeder seiner Auftritte ist groß inszeniert und das ist umso schmerzlicher, wenn eigentlich klar ist, dass sein Darsteller seit über 20 Jahren tot ist – und seine Rolle es auch hätte bleiben sollen.
Star Wars funktioniert auch ohne seine alten Helden
Unser Fazit: Auch wenn Rogue One anfangs lange braucht, um in Gang zu kommen, ist er ein großartiger Film geworden. Der vor allem damit visuell begeistert, wie er die bekannte Star-Wars-Ikonografie in einen neuen Kontext setzt. Die AT-ATs, die über einen idyllischen Sandstrand stampfen statt durch den Schnee von Hoth, sind nur eines von vielen Beispielen. Das Spinoff zeigt vor allem das Potenzial für alle die fantastischen Geschichten, die noch in der Star-Wars-Welt stecken – auch ohne Luke und Rey.
Denn viel besser, als seine alten Helden wiederzubeleben, etwa in der kommenden Han-Solo-Jugendgeschichte, würde es Star Wars stehen, das auszubauen, worin Rogue One trotz CGI und Uncanny Valley glänzen konnte: Die Abenteuer neuer, bislang unbekannter Charaktere in diesem magischen Universum zu erzählen.
Rogue One: A Star Wars Story kommt am 15. Dezember in die deutschen Kinos.