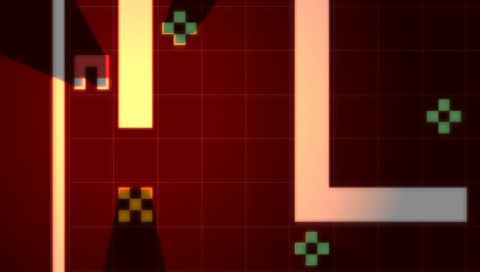Ich bin angespannt, meine Hände schwitzen. Zuletzt gespeichert habe ich vor einer Stunde — wann es wieder soweit ist? Ich habe keine Ahnung, geschweige denn davon, wie ich bis dahin überleben soll. In dieser Rat- und Rastlosigkeit verbringt man 90 Prozent der Spielzeit von „Alien: Isolation“.
Anstatt des ewigen Mantras des sogenannten „Flows“ zu folgen, bricht „Alien: Isolation“ absichtlich mit dieser Konvention.
Was das Spielerlebnis und den Horror intensiv macht, ist nicht die realistische Grafik sondern das archaische Spieldesign. Mit Mechanismen, die in modernen Titeln eigentlich als fatale Designfehler gelten würden. Anstatt des ewigen Mantras des sogenannten „Flows“ zu folgen, bei dem Spieler auf keinen Fall aus dem Spielerlebnis gerissen werden dürfen, lässt mich „Alien: Isolation“ absichtlich ins offene Messer laufen.

Anstatt mich an die Hand zu nehmen und durch ein gemütliches Tutorial zu schicken, muss ich selbst herausfinden, wie meine Ausrüstungsgegenstände funktionieren. Mir wird nicht erklärt, wann man sie benutzen sollte und gegen welche Gegner sie überhaupt effektiv sind. Ewig streife ich am Anfang durch leere Gänge, bis aufs Äußerste gespannt, wann das eigentlich Spiel beginnt. Doch sobald ich auf die ersten Gegner treffe, wird mir die Gnadenlosigkeit von „Alien: Isolation“ bewusst. Denn auch meine Begegnung mit Menschen ist kurz und tödlich.
Dennoch kann ich es nicht vermeiden, dass sie auf mich aufmerksam werden, wenn ich in den großen Saal schleiche. Die Tür ist einfach zu laut. Doch weder hat mir das Spiel erklärt, wie die Rauchbombe zur Ablenkung funktioniert, die ich gefunden habe, noch verstehe ich, wie der Noisemaker eingesetzt werden muss, den ich gerade selbst gebastelt habe. Am Ende bestehe ich den Abschnitt dann doch ganz anders, nämlich indem ich die Gegener einzeln hinterrücks mit dem Schraubenschlüssel erschlage und dabei alle meine Medipacks verschwende.

Während dieser zeitraubenden Szene wird mir schnell klar, wie irritierend sich das Savegame-System des Spiels verhält. Wenn ich denke, einen extrem schwierigen Abschnitt endlich zum ersten Mal gemeistert zu haben, wartet nicht das Autosave nach der Zwischensequenz auf mich, wie ich es von modernen Spielen gewohnt bin. „Alien: Isolation“ erhöht stattdessen den Einsatz — indem es mich ohne Umwege in die nächste, noch gefährlichere Szene wirft. In der komme ich augeblicklich ums Leben, nur um zu merken, dass mein Erfolg der letzten Stunde völlig umsonst war. Das Spiel macht das mit voller Absicht.
Ein Spiel, das Spieler überall speichern lässt, treibt sie zur Selbstoptimierung.
Vor jeder noch so kleinen Hürde kann dafür gesorgt werden, dass sie optimal gelöst wird. Anstatt einen durch eine Kette von Herausforderungen zum Äußersten zu motivieren und auf Hochtouren zu bringen, ist es ermüdend komfortabel. Eine selbstgefälliger Komfort, an den sich Videospieler bereits lange gewöhnt haben. Die traditionellen Mechanismen der Frustration wurden aus modernen Spielen nahezu komplett wegrationalisiert.
Doch durch diese Banalisierung der Herausforderung geht der Adrenalinkick des nahezu Unschaffbaren verloren. Das Erlebnis, seinen Controller frustriert in die Ecke zu werfen, ist in modernen Spielen nicht mehr einprogrammiert. Eigentlich gibt es aber nichts zufriedenstellenderes, als endlich auf einen Savepoint zu treffen, nachdem das Spiel einen zum wiederholten Mal durch eine viel zu lange Episode getrieben hat, bei der man keinen Fehler machen darf. Doch selbst dort dauert das Speichern so endlos lange, dass man in der ewigen Furcht lebt, sich nach dem Speichern umzudrehen und in das Gesicht des Alien zu blicken.

Während solche Dinge bei alten SNES-Spielen meist schlechte Designentscheidungen waren, macht „Alien: Isolation“ das alles ganz bewußt. Das Spiel zwingt mich zu harten Entscheidungen: Soll ich zurück zum nur 20 Meter entfernten Speicherpunkt, während im nächsten Raum das Alien umherstreift? Oder Augen zu und durch, immer in der Hoffnung, dass es bald eine bessere Speicher-Möglichkeit gibt?

Es ist das gnadenlose Überleben des Stärkeren — denn so gnadenlos wie der Feind, das Alien, sind auch die Spieledesigner zu mir. Sie zwingen mich durch einfache Tricks dazu, dass ich mich wirklich so alleine und zurückgelassen fühle wie Ripley. In Situationen, die ungemütlich sind, ich meine Gaming-Komfortzone verlassen muss und nicht mehr weiß, was ich tun soll. Eigentlich etwas, das bei modernen Videospielen als völlig verpönt gilt.
Auch wenn es in „Alien: Isolation“ viele Momente gibt, in denen man genervt ist und glaubt, nie mehr zum Spiel zurückzukehren, es ist genau das, was das Spiel so besonders macht. Denn man trägt es so den ganzen Tag mit sich herum. Man fühlt sich durch die Rätsel, die es aufwirft, und die Frustration, die es hervorruft, angeregt. So reift zum Beispiel über den Tag hinweg langsam eine neue Idee in mir an, wie ich einen Abschnitt doch noch schaffen kann. Und sollte ich ihn schaffen, dann ist das Erfolgserlebnis noch größer. Und genau weil solche Erlebnisse in modernen Spielen heute so selten geworden sind, ist „Alien: Isolation“ einzigartig.