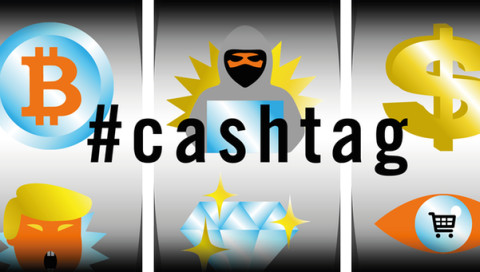Ein höfliches Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf mit Foto, dazu noch die Kopien der Zeugnisse – und schon ist sie fertig, die klassische Bewerbung. Im Idealfall mündet sie in einem Vorstellungsgespräch. Aber was ist, wenn dem Personaler der eigene Nachname oder die Hautfarbe nicht gefällt? Vielleicht stolpert er über die Vier in Mathe? Oder nimmt er den rothaarigen Kandidaten, weil er ihm auf dem Foto sympathischer vorkommt?
Immer wieder wird über Diskriminierung bei der Personalauswahl berichtet. Gerade in kleineren Firmen sind außerdem nicht immer echte Profis für die Talentsuche, das Recruiting, zuständig. Sie picken schon mal einen unpassenden Bewerber heraus. Falls sie überhaupt noch Bewerbungen bekommen. Denn mittlerweile müssen Personaler oft nach ihren Traummitarbeitern fahnden. Sie durchforsten soziale Netzwerke nach jungen Talenten und sprechen sie direkt an. Das kostet Zeit und Geld.
Start-ups wollen all das ändern und besser machen – und setzen dabei immer öfter auf Künstliche Intelligenz. Vor allem in zwei Bereichen kommt inzwischen KI zum Einsatz: Zum einen gibt es Algorithmen, die das „Matching“ für Unternehmen übernehmen. Sie kommen also am Anfang des Prozesses ins Spiel und sollen geeignete Bewerber für eine Stelle identifizieren. Zum anderen gibt es Softwarelösungen für die „Diagnostik“, also um Bewerber genauer unter die Lupe zu nehmen. Anhand von Audiodateien oder Videoaufnahmen sollen KIs erkennen, welche Eigenschaften, welche Stärken und Schwächen die Kandidaten mitbringen. Sie sollen herausfinden, ob sie der Aufgabe wirklich gewachsen sind.
Welche Erfahrungen haben Unternehmen damit gemacht? Glauben Start-ups, die KI für dieses Segment anbieten, tatsächlich, dass Roboter die besseren Personaler sind? Und was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Fragen über Fragen. WIRED hat sie mit Experten diskutiert. WIRED-Autorin Cindy Michel wollte außerdem wissen, wie es sich anfühlt mit einem Bot über die eigenen Gehaltsvorstellungen zu sprechen. Sie hat deswegen MeetFrank ausprobiert, die erste anonyme Recruitment-App. Er fällt in die Kategorie der Matching-KIs.
Cindy, Frank und der perfekt Match
Ich habe Frank getroffen. Der erste Eindruck war eigentlich ganz gut, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Er wirkte wie einer dieser Typen, die ziemlich direkt sind. Nach einer angenehm kurzen „Hey, wie geht’s dir?“-Smalltalk-Phrase legte Frank sofort los. Er wollte wissen, wo ich arbeite, in welcher Branche ich tätig bin, wo meine Expertisen liegen, wie viel ich aktuell verdiene, was ich mir geldtechnisch in Zukunft vorstelle und warum ich eigentlich meinen Job wechseln will. Ich scrollte durch die Multiple-Choice-Antworten und fand bei fast allem, was der Bot von mir wissen wollte, eine ziemlich passende Auswahlmöglichkeit. Um die Registrierung abzuschließen, musste ich noch angeben, wo ich in Zukunft arbeiten möchte und wie viele Jahre Berufserfahrung ich habe. Mehr wollte Frank nicht von mir wissen. Ich bin gespannt, welche Jobs er mir vorschlagen wird.
Frank ist keine Dating App, sondern ein Chatbot und das virtuelle Gesicht von MeetFrank, Deutschlands erster App für anonymes Recruiting. Diese hatte vor knapp vier Wochen ihren Pre-Launch und ist ein künstlich intelligentes Matching- oder auch Matchmaking-Tool. Eine Anwendung, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber anonym und frei von Vorurteilen zusammenbringen will. Ein bisschen wie Tinder für den Arbeitsmarkt.

Ähnlich wie Tinder nur für die Karriere: Die Recruitment-App MeetFrank will den perfekten Match für Arbeitgeber und Arbeitnehmer finden.
Der Chat ist bei MeetFrank die Schnittstelle, an der Infos an den Nutzer gegeben und Informationen über ihn gesammelt werden. Der Algorithmus dahinter vergleicht die Angaben von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und paart jene, mit der höchsten Übereinstimmung. Der Matchmaking-Algorithmus lernt aus den erfassten Daten.
Das war’s. Die Registrierung hat gerade mal zwei Minuten gedauert. Bevor Frank sich höflich mit Winke-Emoji verabschiedet, sendet er mir noch einen Link zu meinem persönlichen „Digest“. Dabei handelt es sich um eine Art Tageszusammenfassung, in der ich neben einem Überblick über die allgemeinen Gehaltsvorstellungen in der Branche schon erste Jobvorschläge finde. Von einem perfekten Match bin ich allerdings weit entfernt, die höchste Übereinstimmung liegt bei gerade mal 47 Prozent. Vielleicht liegt es ja daran, dass Frank nur so wenig von mir wissen wollte?
„Nein“, sagt Kaarel Holm, Mitgründer und Geschäftsführer von MeetFrank. „Wir sind überzeugt davon, dass keine App oder Software Kriterien wie Durchsetzungsfähigkeit oder Teamwork verlässlich erfassen kann. Wenn solche Softskills in einem Profil angegeben werden sollen, beruhen diese Angaben auf Selbsteinschätzungen, die wenig verlässlich sind.“ Auch private Infos zu Alter, Geschlecht oder Herkunft der Nutzer erfasse die App nicht. „Brauchen wir nicht. Bewerber müssen nur ihre Fähigkeiten und beruflichen Ziele angeben, damit die App ihnen passende Stellenausschreibungen vorschlagen kann“, so Holm. Dass soll Diskriminierung ausschließen und die Diversität in Unternehmen fördern. „Unter dem Strich sind die Fragen so aufgebaut, dass MeetFrank versteht, welche Hauptaktivitäten die Nutzer in Ihrem Unternehmen mindestens zehn Stunden pro Woche durchführen“, erklärt der Gründer. Aktuell nutzen mehr als 2000 Firmen die App, in Deutschland Daimler, E.ON, DeliveryHero, SumUp, Blinkist, HIGH Mobility oder auch MyTaxi.
„MeetFrank ersetzt nicht das persönliche Gespräch, sondern sorgt dafür, dass der Matchmaking-Prozess wesentlich schneller und effizienter gestaltet ist. Nach einem Match, kann der Bewerber in einem privaten Chat mit dem Unternehmen in Kontakt treten“, erklärt der Gründer aus Estland.
Schnell und effizient – darauf stehen Personalmanager
Thomas Belker, Vizepräsident des Bundesverband der Personalmanager sieht ebenfalls Potenzial beim Einsatz von KI im Recruitment-Sektor: „KI kann Geschwindigkeit und Flexibilität bringen, Qualitäten verbessern, Kosten senken und sowohl den Match zwischen Bewerber und Unternehmen sowie auch die Personalentwicklung deutlich optimieren.“ Das klingt erstmal so, als könnte Künstliche Intelligenz alle Probleme lösen. Doch Thomas Belker hat noch mehr über KI zu sagen: „Sie ersetzt nicht den Menschen.“ Am Ende müssen aus seiner Sicht Menschen die Auswahl treffen und sich zur Zusammenarbeit entscheiden. Auch während der Zusammenarbeit, vor allem in schwierigen Phasen, seien Menschen dafür verantwortlich, dass am Ende etwas Gutes herauskommt.
Belker hat sich aber nicht nur als Vizepräsident des Verbandes mit KI beschäftigt, sondern auch als Personalchef der Talanx-Versicherung: Der arbeitet seit gut einem Jahr mit Precire zusammen. Das Technologie-Start-up aus Aachen wurde 2015 durch seine Analyse-Software zur Stimmdiagnostik bekannt. Deren KI soll allein anhand der Sprache ein detailliertes Persönlichkeitsprofil eines Menschen erstellen. Damit soll ermittelt werden, ob ein Bewerber zum Unternehmen passt.
Diagnose am Telefon: Ruf mich an, ich sag’ dir wie du bist!
Precire sucht in der Sprache nach individuellen Mustern. Daraus soll sie Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale ableiten. Die Idee dahinter stamme aus der Arbeit mit klassischen psychologischen Testverfahren, sagt Christian Greb, einer der Precire-Gründer. „Es ist aufgefallen, das Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen auch unterschiedlich kommunizieren.“ Dominante Menschen etwa würden öfter das Wort „ich“ benutzen, während neugierige viele Fragen stellen. „Dem wollten wir auf den Grund gehen, so sind die ersten Studien entstanden, die erfolgreich waren, und daraus dann letztlich auch die Technologie.“ Alles, was die KI für ihre Analyse braucht, sind 15 Minuten. Genauer gesagt: ein viertelstündiges, automatisiertes Telefoninterview mit dem Kandidaten.
Über eine halbe Million mögliche Eigenheiten analysiert die Software. Sie misst etwa die Länge der Pausen, die Häufigkeit einzelner Wörter oder Variationen in der Stimme. Relevant für die Berechnung ist auch wie lang oder verschachtelt die Sätze sind, wie emotional oder verkopft die Sprache ist. Selbst die Anzahl der Füllwörter oder Pronomen spielt eine Rolle. Keine Rolle hingegen spielt der Inhalt des Interviews, denn der sei für die Analyse völlig irrelevant und werde auch nicht verwendet. Ein Bewerbungsgespräch der anderen Art.
Anders als Precire setzt zum Beispiel das amerikanische Start-up HireVue auf Video statt auf Audio. Dabei handelt es sich um eine digitale Plattform für Vorstellungsgespräche. Bewerber absolvieren auch hierbei ein standardisiertes Gespräch, lassen sich dabei aber auch mit einer Kamera aufzeichnen. Der Algorithmus der Plattform analysiert das Video, achtet auf etwa Körpersprache, Tonlage der Kandidaten oder bestimmte Schlüsselwörter. Wer gut abschneidet, wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Auf HireVuew setzen Großkonzerne wie Unilever oder Nike.
Precire macht nicht mehr in Recruiting, sondern in Entwicklung
Auch das Aachener Start-up Precire hat es zu namhaften Kunden gebracht. Denen bietet es seine KI aber nicht mehr nur für die Diagnostik bei der Personalsuche an. Mittlerweile hat das junge Unternehmen weitere Geschäftsfelder erschlossen und sich auf eines fokussiert, das lohnender scheint: die Personalentwicklung. „Hier schauen wir weniger auf die Persönlichkeit, auch wenn wir für die bereits nachgewiesen haben, das wir sie messen können“, sagt Christian Gerb, „sondern mehr auf trainierbare Aspekte.“ Wenn etwa eine Führungskraft feststelle, dass sie extrem autoritär kommuniziere, obwohl dies nicht zur Teamkultur passe, könne sie Übungen machen, die ihr helfen, die gewünschte Wirkung zu erzielen. Mit einer App könnten die Mitarbeiter die Chance bekommen, selbst an sich zu arbeiten – ohne Anweisung von oben. „Ähnlich wie bei Fitness Apps“, sagt Greb. Die Entwicklung so einer App ist bereits in Planung.
Ob Künstliche Intelligenz bei der Personalentwicklung helfen kann, ist zwar nicht die eigentliche Frage dieses Artikels. Aber interessant an dem neuen Einsatzgebiet der Precire-KI ist, dass sie hier einen Vorteil haben könnte, der bei der Suche nach Personal genauso entscheidend ist: Sie sei weniger voreingenommen gegenüber ihren Gesprächspartnern als menschliche Personaler oder Coaches, sagt Greb. Denn: „Was wahrgenommen wird, wird interpretiert und ist durch die Vorerfahrungen dieses einen Menschen bedingt. Precire ist viel objektiver und sieht daher Sachen, die andere Menschen nicht wahrnehmen.“ Macht dieser Vorteil Maschinen zum besseren Personaler? „Dadurch sind sie nicht die besseren Personaler. Zum Personaler sein gehört deutlich mehr, als Persönlichkeit und Wirkung richtig einzuschätzen“, sagt Greb. „Es bringt ja nichts, wenn er von seiner Persönlichkeit her perfekt geeignet wäre, es aber nach wenigen Tagen mit dem neuen Chef knallt.“
So setzt auch der Versicherungskonzern Talanx die Precire-KI bei der Personalentwicklung ein: Ob die psychologischen Merkmale, die die KI bei Mitarbeitern identifiziert, nun Stärken oder Schwächen seien, das würden immer noch Personaler entscheiden, sagt Personalchef Thomas Belker. „Und wie immer im Leben ist das kein apodiktisches Ja oder Nein, sondern eine Frage, die von vielen unternehmensbezogenen Aspekten abhängt." Die sind wohl eine Nummer zu kompliziert für eine KI.
Marketing-Hype statt unabhängiger Studien?
Bisher klingt alles ganz positiv, so als könne KI die Personaler dieser Welt zumindest entlasten und unterstützen. Es gibt aber auch echte Kritiker, zum Beispiel den Wirtschaftspsychologen Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück: „Im Moment sehe ich kein seriöses Einsatzgebiet, zumindest nicht, wenn es um Fragen der Diagnostik im Sinne von Personalauswahl oder Potenzialanalysen geht“, sagt er zu WIRED. Von Algorithmen, die anhand von Aufnahmen etwas über die Eignung von Kandidaten ermitteln sollen, hält der Wissenschaftler Kanning wenig. Denn wer wisse schon genau, welche Faktoren die Gesichtserkennungssoftware der KI verwendet, um Aussagen über die Persönlichkeit zu treffen, – und warum. „Unternehmen müssen sich einfach mit KI auseinandersetzen und recherchieren wie die Algorithmen funktionieren und wie aussagekräftig die Daten überhaupt sind.“ Er verweist auch auf die Pseudowissenschaft Psycho-Physiognomik, die behauptet, anhand der Schädelform, der Gesichtszüge, der Form von Nase und Ohren Aussagen über die Persönlichkeit eines Menschen treffen zu können. „Wenn so etwas der Fall sein sollte, dann ist das eh völliger Blödsinn."
Auch eine Sprachanalyse, die berufliche Leistungen prognostizieren soll, sieht Kanning kritisch. Zum einen sei es nur bedingt möglich, Charaktereigenschaften eines Menschen durch die Analyse seiner Sprache richtig zu deuten, so Kanning. Das hätten wissenschaftliche Studien gezeigt. Zum anderen, meint Kanning, liege schlichtweg ein Denkfehler vor: „In der Eignungsdiagnostik geht es nicht darum, persönliche Merkmale zu messen. Es geht darum, die berufliche Leistung eines Kandidaten zu prognostizieren.“ Sein Argument: Wer wisse schon genau, welche Eigenschaft wirklich für die Leistung eines Menschen verantwortlich ist? Wenn man also bei einem Mitarbeiter etwa eine hohe Gewissenhaftigkeit diagnostizieren würde, hieße das laut Kanning noch lange nicht, dass dieses Merkmal ein verlässlicher Indikator für eine hohe berufliche Leistung sei.
Wie gut eine KI ist, lässt sich schwer einschätzen
In den meisten Unternehmen fehle das fachliche Know-how um solche Produkte qualitativ richtig beurteilen zu können, sagt der Wissenschaftler. Viele würden sich einfach blind auf das clevere Marketing einiger Start-Ups verlassen. „KI ist gerade ein großer Hype, den man gut vermarkten kann“, so Kanning. Er bemängelt, dass es keine unabhängigen Untersuchungen dazu gäbe: „Studien zu den KI-Produkten werden von den Unternehmen selbst in Auftrag gegeben. Das ist wie die Marlboro-Studie zur Gesundheit des Rauchens. Der Kunde kauft letztlich die Katze im Sack.“
Neben der Diagnostik gibt es ja noch den zweiten großen Ansatz, den Start-Ups für KI im Recruiting verfolgen: das Matching. „Das wiederum kann sinnvoll sein, wenn die Software in der Lage ist beim Bewerber valide Daten zu erfassen und diese mit den tatsächlichen Anforderungen der Stelle abzugleichen“, sagt Kanning.
Laut Wissenschaft könnte die Matching-App MeetFrank also Potenzial haben. Vielleicht hat sie ja schon mein perfektes berufliches Match gefunden. Ich checke meine Tagesübersicht: ein neues Angebot…