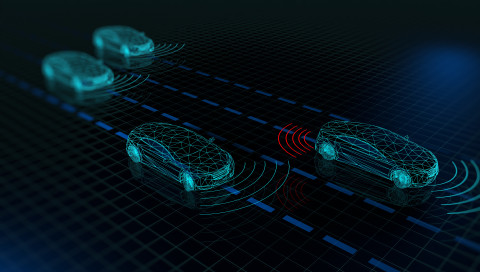Geht es um automatisiertes Fahren, ist Deutschland gefühlt in zwei große Lager gespalten. Die einen freuen sich auf ihr erstes Nickerchen im selbstfahrenden Dienstwagens. Die anderen misstrauen den Maschinen und wollen das Lenkrad nicht aus der Hand geben. Und dann gibt es da noch die dritte Gruppe. Die besteht aus den Leuten, die sich ganz nüchtern auf die Zukunft mit autonomen Autos vorbereiten.
Sie stellen sich zurzeit ziemlich grundsätzliche Fragen: Wie wollen wir eigentlich in Autos sitzen, die ohne unsere Hilfe fahren? Wie viel Aufmerksamkeit wird man den Menschen noch abverlangen müssen? Und: Werden Unfälle anders auf uns wirken, wenn wir sie gar nicht mehr kommen sehen, weil überhaupt nicht auf den Verkehr achten?
Kristian Seidel gehört zu dieser dritten Gruppe von Menschen – und arbeitet daran, solche Fragen zu beantworten. Der Ingenieur erforscht am Institut für Kraftfahrzeuge, kurz ika, der RWTH Aachen mit vielen Kollege, wie Autobauer auch in Zukunft sichere Fahrzeuge herstellen können. Sein von der EU gefördertes Projekt nennt sich Future Occupant Safety for Crashes in Cars oder einfach OSCCAR. Das Ziel ist, die Insassen-Sicherheit bei Unfällen von automatisierten Fahrzeugen zu verbessern.
Autonome Autos werden andere Unfälle haben
Eines lässt sich nämlich jetzt schon ziemlich sicher voraussagen: wenn sich automatisiertes Fahren auf unseren Straßen etabliert, ändert sich nicht nur die Art, wie wir Auto fahren, sondern auch die Art, wie Unfälle passieren. Klingt nach ziemlich trockener Forschungsmaterie, ist aber von essentieller Bedeutung, damit sich Roboterautos überhaupt durchsetzen können.
Ein Beispiel für „neue“ Unfälle: Wenn das selbstfahrende Auto ruckartig reagiert und selbst der Fahrer von der Bewegung komplett überrascht wird, können hohe Kräfte wirken. Man spricht auch von der Pre-Crash-Kinematik, die am Werk ist, wenn das Fahrzeug auf eine drohende Gefahr reagiert. Momentan kommt diese Reaktion noch vom Fahrer selbst. Er weiß im Zweifel kurz vor einem Crash oder einer Vollbremsung, was ihn wenige Millisekunden später erwarten könnte und wie sich seine Körperhaltung und die Wirkung konventioneller Rückhaltesysteme auswirken könnte. Das ändert sich, wenn er die Steuerung dem Auto überlässt.
Die Forschungsgruppe, zur der Kristian Seidel gehört, denkt nicht in bisherigen Strukturen. „Crash-Dummies können unterschiedliche Körper simulieren, sie decken aber nicht das komplette Spektrum menschlicher Physiologie ab“, sagt er zu WIRED. Daher setzt die Gruppe auf eine Mischung aus physischer Simulation mit Dummie-Crashs und virtuellen Crash-Tests. Dabei kommen Human Body Models zum Einsatz, also digitale Modelle des Menschen.
Die Software soll eine noch höhere Bio-Fidelität als Versuche mit Kunststoff-Dummies erreichen. Das heißt, sie soll möglichst exakt und realistisch berechnen, wie verschiedene Körpertypen auf die möglichen Belastungen reagieren. Computer sollen prognostizieren, welche Knochenbrüche und welche Organschäden bei einem Unfall zu erwarten sind und wie stark die Insassen durch die Pre-Crash-Kinematik durchgeschüttelt werden. Auch Änderungen der Demografie werden mitbedacht. Deutschland wird älter – und alte Knochen brechen nun mal leichter.
Noch sollte man die Autonomie der Autos nicht überschätzen
Noch müssen menschliche Fahrer die Straße permanent im Blick haben, denn die Autonomiestufe der Autos ist recht niedrig. „Heutige Fahrzeuge bieten maximal Level 2, dabei muss der Fahrer das System dauerhaft überwachen“, erklärt Seidel. Level 2 entspricht dabei beispielsweise dem Einpark-Assistenten, der bis zu einem gewissen Grad zwar selbstständig arbeitet – aber ständige Aufsicht und die Mitwirkung des Fahrers braucht.
Auch der Spur-Assistent vieler Fahrzeuge gehört zu Level 2. Der entlastet den Menschen zwar gerade auf langen Autobahnfahrten. Er nimmt ihm aber nicht das Fahren ab. „Die Vermarktung der Systeme weckt diesbezüglich leider zum Teil falsche Erwartungen“, ergänzt der Ingenieur. Fahrer gingen ein hohes Risiko ein, wenn sie die Selbstständigkeit der Systeme überschätzen würden. „Das Ziel ist aber Level 4 und 5“, so Seidel. Bis die Autobauer dorthin kommen müssen sie erst noch Stufe 3 flächendeckend ausrollen.
Bei Stufe 3 kann man das Fahrzeug über längere Abschnitte gewähren lassen. Es wechselt dann zum Beispiel selbstständig die Spur. Der Fahrer wäre erst dann gefragt, wenn Entscheidungen verlangt sind, die über derart einfache Manöver auf Autobahnen hinausgehen. Erst bei Stufe 4 wäre der Punkt erreicht, bei dem sich der Fahrer während der Fahrt auf dem oft herbeigesehnten Drehstuhl zu seinen Passagieren drehen kann – und ein Kartenspiel starten könnte. Bis dahin ist es noch ein recht weiter Weg. Selbst die optimistischen wissenschaftlichen Prognosen gehen von einer Level-3-Abdeckung der Hälfte des Straßenverkehrs erst in gut 30 Jahren aus. Trotzdem sollten wir uns langsam überlegen, was passiert, wenn man vom LKW gerammt wird, während man eine Runde Poker spielt.
Werden wir in Zukunft „seekrank“ auf der Autobahn?
Aber es geht bei OSCCAR nicht nur um potentiell blutige Crashs, sondern auch darum, unser mögliches Nutzerverhalten bei autonomen Autos zu erforschen. Das Projekt läuft erst wenige Monate, die erste Studienphase ist aber bereits beendet. Nur veröffentlicht sind die Ergebnisse noch nicht. Allzu weit will sich Kristian Seidel daher nicht aus der Deckung wagen – und dennoch: „Ein wichtiger Aspekt könnte die Gewöhnung werden.“ Die Gewöhnung an Autos, die selbst lenken. Denn noch hätten viele Probanden eine Sitzposition mit Blick in Fahrtrichtung bevorzugt, da sie Motion Sickness fürchteten. Einfacher gesagt: Sie hatten Angst, seekrank zu werden. Außerdem sei eine Blickrichtung nach links als angenehmer empfunden worden, als der Blick nach rechts. Für die Projektgruppe könnte sich das aber mit einer gewissen Gewöhnung relativieren.
„Die linke Seite ist vermutlich beliebter, weil sich dort der Verkehr abspielt“, vermutet Seidel. Wenn die seitliche Sitzposition aber erstmal Normalität geworden sei, dann sei das nicht mehr wichtig. „Haben Sie schon mal in der Bahn darauf geachtet, was im Gegenverkehr passiert? Nein. Sie wissen, dass es nicht nötig ist, draußen alles im Blick zu haben und konzentrieren sich auf ihren Laptop oder ihr Buch.“
Bei OSCCAR geht es einerseits um Grundlagenwissen, gleichzeitig aber auch um echte Anwendungen. Schon jetzt nutzen die Aachener eine eigene Crash-Anlage, auf der sie zusätzlich zu den Simulationen auch physische Dummies einsetzen. Die Forschung zur Sicherheit automatisierter Fahrzeuge steckt aber noch am Anfang. Wir alle müssen Geduld haben, meint Seidel. „Wir sind noch in der Lernphase. Die Systeme gehen jetzt zur Fahrschule, das dauert beim Menschen auch eine Weile.“ Viele Wissenschaftler beschäftigen sich zurzeit mit dem Thema. So wird unter anderem eine Datenbank möglicher Fahr- und Unfallsituationen aufgebaut. Eine Mammutaufgabe: Schließlich sollte diese möglichst alle denkbaren kritischen Situationen im Verkehr beinhalten, damit auf dieser Basis auch alle möglichen Folgen auf die Fahrzeuginsassen kalkuliert werden können.
Autobauer begleiten das Projekt
Ziel müsse es laut Seidel schließlich sein, dass die Fähigkeiten der automatisierten Fahrzeuge zumindest denen eines durchschnittlichen, menschlichen Fahrers ebenbürtig sind. Beim auf drei Jahre angelegten OSCCAR-Projekt soll am Ende noch keine marktreife Lösung herumkommen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse durchaus Einfluss auf die Architektur zukünftiger Autos haben könnte. Denn diverse Autobauer sitzen beim Projekt mit im Boot. Ob in 30 Jahren dann beim Fahren Poker gespielt wird, ist zwar noch offen. Aber es erscheint durchaus möglich. Wir sollten also darauf vorbereitet sein.