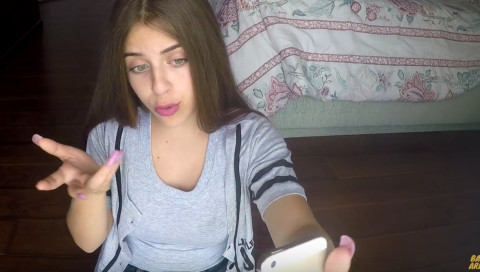Mehdi Benjelloun, besser bekannt als Petit Biscuit, veröffentlichte seinen ersten Hit Sunset Lover zuerst bei Soundcloud. Für die ruhige Elektro-Nummer reichen dem 15-Jährigen im Sommer 2015 wenige Zutaten: eine Gitarren-Line, Kick-Drum und dazu hochgepitchter Gesang. Bei Spotify startet Sunset Lover in kleinen Playlisten wie Electro Chill von Spotify Frankreich. „Wir hatten kein großes Marketing, wir hatten nur einen guten Song“, sagt David Weiszfeld, Benjellouns Manager. Aber das Streaming-System wird ihren Sound in den kommenden Jahren belohnen.

Mehdi Benjelloun alias Petit Biscuit
„Sunset Lover“ funktioniert: Wenige Hörer drücken den Song weg, viele hören ihn immer wieder an und speichern ihn als Favorit. Das wiederum bugsiert ihn in immer größere Playlisten. Die erste ganz Große heißt Mint, eine Spotify-Playlist für elektronische Musik mit 4,5 Millionen Followern. Sunset Lover ist ein perfektes Beispiel für eine musikalische Erfolgsgeschichte, wie sie heute bei den Streaming-Anbietern abläuft.
Die Playlisten von Streamingseiten wie Spotify gleichen kleinen Radiostationen für eine bestimmte Hörerschaft: Generation Deutschrap für Fans von Kollegah und Farid Bang, Kaffeehausmusik für Anhänger von Singer-Songwriter-Gitarren oder auch Alone Again, eine Playlist extra für Frischgetrennte oder Dauersingles. Allein bei Spotify gibt es aktuell 4500 solcher kuratierten Playlisten, aus Deutschland kommen rund 150 davon.
Dennoch hinkt der Vergleich zu Radiosendern: Läuft ein neuer Song bei einer bestimmten Station, heißt das nicht, dass andere Sender ihn auch spielen. Bei den großen Streamingseiten gehen die Musikredakteure anders vor, ihre Auswahl hat nicht nur mit Geschmack oder Programm-Komposition zu tun. Für sie ist entscheidend, wie ein Song ankommt – wer ihn wie oft und wann abspielt. Sie sammeln Daten, die zeigen, ob ein Song ganz durchgehört oder übersprungen wird, und in welchem Moment. Wenn ein Song in einer Playlist gut funktioniert, übernehmen die Redakteure ihn auch in andere Listen.
Als Rampe und Testfeld dienen kleinere Listen: Manchmal generieren User oder Unternehmen sie selbst für einen bestimmten Zweck, manchmal schneidet ein Algorithmus sie auf jeden einzelnen Nutzer zu, wie bei Dein Mix der Woche. Doch wirklich entscheidend sind die kuratierten Listen. Die sind prominent auf den Streamingseiten platziert und versammeln die meisten Follower. Außerdem werden Songs, die auf den kuratierten Playlists erfolgreich sind, auch wieder in die individuellen, von Algorithmen zusammengestellten Playlisten zurückgespielt. Es entsteht eine Aufwärtsspirale.
Das weiß auch Manager Weiszfeld. Schon damals macht er Spotify konkrete Vorschläge, in welche der kuratierten Playlisten der Song seines Künstlers passen würde. In sechs Monaten schafft es der bisher völlig unbekannte Song Sunset Lover so in die Today’s Top Hits, mit über 17 Millionen Followern weltweit. Bis heute hat der Song alleine auf Spotify über 224 Millionen Streams. „Das war ein Beweis, dass das Konzept funktioniert“, behauptet Weiszfeld. „Wenn Spotify etwas mag, pushen sie es. Und sie mögen es, wenn man richtig mit ihnen spricht.“
Man könnte Weiszfeld als jemanden bezeichnen, der das System verstanden hat und versucht, davon zu profitieren. Der Manager hat sogar die passende Software dazu geschrieben: Soundcharts. Mit dem Monitoring-Programm für Streamingdienste können Musikschaffende den Erfolg der eigenen Musik beobachten, genauso wie das Abschneiden der Konkurrenz. Weiszfeld kann nachvollziehen, wie die Kampagnen von erfolgreichen Künstlern aus dem gleichen Genre liefen und versuchen, diese zu imitieren. „Will ich gleich in eine sehr große Playlist rein, dann wird das Gespräch mit Spotify nicht besonders konstruktiv laufen“, so Weiszfeld. Seine Software liefere eine gute Argumentationsgrundlage. „Das Programm zeigt, nach was ich in welcher Reihenfolge fragen kann. Ich muss mir immer das nächste große Ding vornehmen.“
Songs werden stärker gestrafft und gekürzt für Streaming-Dienste
Streaming-Seiten verändern dabei nicht nur die Vermarktung von Musik, sie haben auch einen Einfluss auf die Musikproduktion selbst. Das liegt an den technischen Strukturen: Spotify wertet einen Song erst nach den ersten 30 Sekunden als gespielt. Nur, wenn ein Lied so lange gehört wird, fließt es in die Charts mit ein und nur dann erhalten die Künstler Tantieme. Das führe dazu, dass der Anfang eines Songs immer voller gepackt werde, sagt Autor Marc Hogan, der im amerikanische Magazin Pitchfork kürzlich beschrieb, wie Streaming den Klang von Popsongs verändert.
Das bestätigen auch Vertreter der Streaming-Seiten. „Songs werden stärker gestrafft und gekürzt für Streaming-Dienste“, sagt Richard Wernicke von Deezer. Das treffe vor allem auf Singles zu, weniger auf Albumtracks. „Ein Albumtrack kann länger sein, mit einem längeren Intro, einem instrumentellen Part, musikalischer oder lyrisch experimenteller.“
Auch Spotify-Sprecher Marcel Grobe glaubt, dass diese Regel eher auf Songs aus den Top-50-Popcharts zutrifft. In der Neo Klassik sei aber zum Beispiel das Gegenteil der Fall. Hier sind Künstler wie Nils Frahm vor allem mit ihren langsamen Instrumentalstücken erfolgreich. In diesen Genres kann sich Grobe kein durchchoreographiertes Song-Intro vorstellen. „Vielleicht werden die Tracks stattdessen einfach kürzer, weil dann häufiger durchgeklickt wird“, vermutet er.
Gleichzeitig veröffentlichen Musiker immer mehr Singles in kürzerer Zeit. „Mehr Künstler fokussieren sich auf Singles und sehen das Album nicht mehr unbedingt als holistisches Werk“, sagt Wernicke. Streaming verkürzt die Nähe zu den Fans, gleichzeitig wollen sie schneller an neue Musik kommen. „Wir glauben, dass sich die Release-Zyklen gerade in der Popmusik verkürzen werden. Künstler werden nicht mehr nur alle zwei Jahre ein Album rausbringen, sondern veröffentlichen vielleicht alle drei bis vier Monate einen Track oder einen Remix, um den Fans etwas zurückzugeben“, sagt Grobe. Das wiederum passt mehr zur Playlistkultur.
Ob die Einordnung der eigenen Musik in solch ein System den kreativen Prozess fördert, lässt sich zumindest anzweifeln. David Weiszfeld ist nach dem Erfolg von Petit Biscuit allerdings überzeugt, dass Streaming-Seiten das Musikgeschäft demokratischer machen: „Wenn nach drei Tagen jeder das Lied wegklickt, schmeißt Spotify es aus den Listen.“ Denn gegen die Daten kommt niemand an.