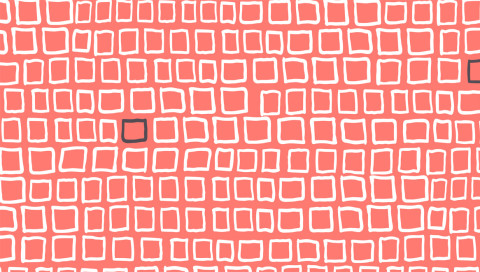1999 veröffentlichten Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, and David Weinberger das sogenannte „Cluetrain“-Manifest. Es war in Form und Anspruch an die 95 Thesen von Martin Luther angelehnt und sollte die sich neu entwickelnden Beziehungen zwischen Individuen, Firmen und anderen Organisationen im Zeitalter des Internets beschreiben, sowie dessen Struktur als Raum des freien Ausdrucks. Dazu postulierte das Manifest 95 Regeln für die kommende vernetzte Zukunft. Das war notwendig, denn die Märkte wurden deutlich schneller „smart“ als die Firmen, die in ihnen agierten.
Das „Cluetrain“-Manifest war sehr optimistisch und wurde — ganz dem Zeitgeist des damaligen Dotcom-Booms entsprechend — sehr positiv aufgenommen und von vielen Experten unterzeichnet. Besonders in der New Economy verstand man es als Auftrag und Motivation, es besser zu machen als die existierenden IT-Dickschiffe.
So wie wir Menschen uns nicht als Geist ohne Körper begreifen können, wird auch das Internet erst durch das Zusammenfügen von Hardware und Software real.
Das Internet sieht heute allerdings ganz anders aus als noch vor 15 Jahren. Durch die von Edward Snowden geleakten Dokumente wissen wir, wie viel Einfluss und Zugriff insbesondere die amerikanischen Geheimdienste auf große Mengen der durch das Internet fließenden Informationen haben. Das hat die Szene der unabhängigen Technikenthusiasten, der Hacker und digitalen Avantgardisten in ihren Grundfesten erschüttert. Neue Firmen sind in den letzten 16 Jahren entstanden beziehungsweise gewachsen und haben die alten IT-Konzerne weitgehend überflügelt, zeigen dabei allerdings oft nur sehr überschaubares Interesse an einem Internet außerhalb ihrer eigenen Silos. Und auch die Zusammensetzung der Netzbewohner selbst hat sich verändert: Anstatt nur aus Hackern, Wissenschaftlern, Künstlern und Zukunftsbegeisterten besteht das Internet heute — zumindest in den westlichen Ländern — aus einem breiten Querschnitt der Gesellschaft.
Ein Update des Manifests war also notwendig und so veröffentlichten zwei der Autoren des ersten „Cluetrains“, Doc Searls und David Weinberger, am 8. Januar 2015 ein neues Thesenpapier. Unter dem Titel „New Clues“ formulierten sie ein neues Verständnis des Netzes und weiteten ihre Betrachtung im Vergleich zum ersten Manifest deutlich aus. Wo zuvor die Märkte und die Beziehung von Unternehmen und Menschen im Fokus standen, versucht sich „New Clues“ an einer Betrachtung des Netzes als globaler sozialer Raum.
Das neue Manifest teilt sich in drei Segmente. Erstens die Beschreibung des abstrakten Internets an sich: Seals und Weinberger versuchen zu beschreiben, was genau das Netz ist — und auch, was es eben nicht ist. Zweitens eine Auflistung der Fehler, die „wir“, also die internetnutzende globale Gemeinschaft in den letzten Jahren gemacht und zugelassen haben. Und drittens eine Anleitung, wie es weitergehen soll, sowie ein Ausblick auf die in den nächsten Monaten notwendigen Diskussionen.
1. Was ist das Internet?
Das Netz wird von den Autoren als sozialer Zusammenhang aller Menschen dargestellt. Als eine Sphäre, in der sich Menschen verbinden, miteinander kommunizieren. Keine Menge aus Inhalten, Videos, Texten und „Hier kaufen“-Links. Kein Medium, wie das Fernsehen oder Zeitungen. Kein Netzwerk aus Computern, Routern und Kabeln, keine technische Meisterleitung. Sondern schlicht eine andere Perspektive auf die Welt. Eine Welt, in der Menschen sich zusammenfinden und austauschen. Eine Welt, die auf dem Gesetz der Netzneutralität aufsetzt: Du sollst alle Daten gleichberechtigt durch dein Netzwerk leiten, egal von wem, egal wohin, egal was drin steckt.
Die Antwort auf die Frage, wie ein Internet ohne Staaten verwaltet und die Einhaltung seiner Regeln garantiert werden soll, bleiben die Autoren schuldig.
Eine schöne Utopie, die an John Perry Barlows „Declaration of the Independence of Cyberspace“ von 1996 erinnert. Und leider hinkt. Denn so richtig und wichtig die Beschreibung des Netzes als soziale Lebensrealität ist, kommen wir nicht umhin zu akzeptieren, dass das Netz ein Mischwesen ist — wie wir Menschen auch. Und genau wie wir Menschen uns nicht nur als Geist ohne Körper begreifen können, so ist auch das Internet eine Art „Cyberphysical System“, ein Objekt, das erst durch das Zusammenfügen von Hardware (Rechner, Netzwerkkomponenten usw.) und Software (Protokolle, sowohl technische als auch soziale) real wird.
Der physische Charakter des Netzes wird uns nicht nur bewusst, wenn Telekomanbieter in kleinen Städten und Dörfern keine akzeptablen Anschlüsse anbieten oder unsere Mobilfunkprovider es nicht hinbekommen, halbwegs flächendeckend oder im Zug mobiles Internet anzubieten. Die Angriffe der Geheimdienste auf das Netz sind vor allem deshalb so einfach möglich, weil es eben auch eine technische Infrastruktur ist. Die Rechenzentren, die diese Infrastruktur bereitstellen, befinden sich in irgendwelchen Staaten und müssen sich den dort geltenden Gesetzen unterwerfen. Deswegen ist das Netz eben kein rein geistiger, von den Zwängen der physischen Welt losgelöster Raum.
Weinberger und Searls scheint das auch bewusst zu sein. Denn die grundlegende Regel, die nach ihrem verständnis allem im Netz zugrunde liegt und liegen muss — die Netzneutralität — ist eine technische, keine soziale: Daten müssen ungehindert und unreglementiert fließen.
Menschen werden von‚Makern‘ zu ‚Consumern‘, gefangen in der durch die Plattformanbieter gefilterten digitalen Realität.
Dem Internet seine Stofflichkeit abzusprechen ist sehr bequem, entbindet diese Argumentation die Autoren doch davon, sich allzu viele Gedanken über staatliche Eingriffe in den Datenverkehr zu machen. „Ihr habt hier nichts zu sagen“, scheinen Weinberger und Searls den Regierungen dieser Welt zuzurufen, die damit sicher nicht zufrieden sein können. Genausowenig wie die Netznutzenden. Denn die Antwort auf die Frage, wie ein Internet ohne Staaten verwaltet und die Einhaltung seiner Regeln (insbesondere der Netzneutralität) garantiert und durchgesetzt werden soll, bleiben die beiden Autoren schuldig.
2. Fehler über Fehler
Searls und Weinberger greifen gleich zu Beginn ihrer Fehleranalyse den vielzitierten „Internet-Hass“ auf. Das Netz hat die Ausgrenzung und Diskriminierung anderer, die verbale Gewalt in Form von Hate Speech nämlich keineswegs abgeschafft. Die Autoren stellen im Gegenteil etwas ratlos fest, dass solche Übergriffe im Netz mittlerweile häufiger wahrzunehmen sind als in der Offline-Welt, eben weil man mehr mit anderen — mit fremden „Tribes“ — konfrontiert sei. Sie fordern deswegen mehr Offenheit, Mitgefühl und Geduld.
Das Manifest fordert außerdem ein Umdenken der Werbetreibenden. Personalisierte Werbung und Native Advertising (früher sagte man Schleichwerbung) seien Ausdruck eines Mangels an Respekt den Menschen —und potentiellen Kunden — gegenüber. Märkte seien „eine Konversation“, ein Austausch basierend auf gegenseitiger Achtung, schreiben die Autoren.
Privatsphäre und ihre Grenzen müssen für eine verknüpfte Gesellschaft neu gedacht und ausgehandelt werden.
Die Entwicklung des Netzes weg vom World Wide Web aus lose miteinander verlinkten Seiten hin zu Apps, die sich gegeneinander abschließen kritisieren sie ebenso wie die Konzentration auf wenige große Plattformanbieter wie Google, Facebook, Amazon und Apple. Menschen würden so von „Makern“ zu „Consumern“, gefangen in der durch die Plattformanbieter gefilterten digitalen Realität. Weinberger und Searls stellen allerdings klar heraus, dass die Unternehmen bei allen Problemen keinesfalls als „böse“ bezeichnet werden können, sondern sich zum Großteil sogar ausgesprochen höflich und nett verhalten.
Zum Abschluss machen sich die Autoren einige Gedanken zur Privatsphäre: Die Regierungen und Geheimdienste haben nun alle Daten, aber können sie wirklich mehr Sicherheit garantieren? Allerdings gestehen Searls und Weinberger ein, dass (wenn man nicht will, dass Regierungen diese Mengen an Daten erheben) man sich nach dem nächsten Anschlag nicht beschweren kann, dass die Regierung nicht genug überwacht hätte. Sicherheit und Privatsphäre stünden in einem Zielkonflikt, dessen Neubewertung die Online-Gesellschaft nicht mehr vor sich herschieben könnte. Privatsphäre und ihre Grenzen müssten für eine verknüpfte Gesellschaft neu gedacht und ausgehandelt werden.
Die angebrachten Kritikpunkte sind alle kaum von der Hand zu weisen, bringen allerdings nur wenige Impulse. Aggression und Übergriffe im Netz werden zur Kenntnis genommen und beklagt, aber es wird nichts zum Umgang damit beigetragen. Wie schon im ersten Teil scheinen die Autoren keine belastbaren Ideen zu haben, wie Normen im Digitalen durchgesetzt werden können oder sollen. Hier fallen sie deutlich hinter den aktuellen Stand der Diskussion um Verantwortung und Konsequenzen für soziale Grenzübertretungen zurück: Wo sich diverse soziale Gruppen und Strukturen öffentlich mit der Aushandlung von Codes of Conduct beschäftigen, kann ein Manifest sich nicht mehr schulterzuckend abwenden.
Facebook hat mehr Menschen Zugang zu benutzbarer Software zur Organisation und Koordination verschafft, als alle Anbieter zuvor.
Natürlich ist es durchaus verständlich, dass Weiberger und Searls die Entwicklung hin zu sich gegeneinander abschirmenden Plattformen kritisieren. Leider blenden sie aber völlig aus, dass sich viele Menschen eben nicht für das Netz an sich interessieren, sondern für das, was sie damit tun. Kritik an Facebook ist berechtigt, aber man kann nicht von der Hand weisen, dass das soziale Netzwerk mehr Menschen Zugang zu benutzbarer Software zur Organisation und Koordination von Menschen und Gruppen verschafft hat, als alle Anbieter zuvor. Der kritisierte Netzwerkeffekt, der dazu führt, dass sich Menschen in den größten Netzen sammeln und diese immer größer machen, ist eben auch ein Vorteil: Wenn alle WhatsApp haben, kann ich alle per WhatsApp erreichen und brauche mir keine Gedanken zu machen, wie ich mit jemandem Kontakt aufnehmen soll. Der Traum, dass alles irgendwie dezentral und möglichst von den Nutzenden selbst im Web gehostet sein soll, ist leider nur für Minderheiten realistisch. Über die Bedürfnisse derer, die das Netz „nur“ benutzen wollen, einfach hinweg zu gehen, erscheint mir unangemessen, wenn man die Zusammensetzung der Internetnutzenden betrachtet.
Andererseits ist es sehr gut, dass die Autoren das Spannungsverhältnis Sicherheit-Privatsphäre (mit zweiterem ist im Text eher die Freiheit von Überwachung gemeint) klar benennen und als Grundrechtsabwägung darstellen. Als ein Kontinuum zwischen zwei Extrempolen, in dem eine Gesellschaft einen Kompromiss aus beiden Bedürfnissen aushandeln muss. An dieser Stelle überwinden Weinberger und Searls die in Technik- und NGO-Kreisen immer noch stark verbreitete Fundamentalopposition, die jede Form staatlicher Datenerhebung ablehnt. Korrekt adressieren sie die Notwendigkeit, Konzepte wie Privatsphäre für eine vernetzte Gesellschaft neu zu diskutieren und an den Lebensrealitäten, Praktiken und Bedürfnissen der Netzbewohner zu neu auszurichten.
3. Pflege und Schutz des Internets
Das Internet hat das Leben verbessert, stellen die Autoren fest: Der Zugang zu Kultur, Informationen und Wissen hat sich massiv vergrößert. Durch die Sammlung und Verknüpfung der Meinungen vieler Einzelner konnte die Macht der Menschen den Unternehmen gegenüber vergrößert werden. Und auch Politiker müssen sich heute ganz anders erklären, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Die offene Struktur des Netzes erzeugt neue Ansprüche und Forderungen der Öffentlichkeit an die politisch oder ökonomisch Mächtigen.
The gravity of connection is love. Long live the open Internet. Long may we have our Internet to love.
Trotzdem sehen die Autoren deutlichen Handlungsbedarf: Die Frage der Finanzierung des Lebensunterhalts von Künstlern und anderen im Netz Schaffenden ist immer noch weitgehend ungeklärt. Wenn alles kostenlos ist, wovon sollen diejenigen leben, die es erzeugen? Im Gegenzug regen Weinberger und Searls eine massive Neuausrichtung des Urheberrechts an. Unsere Kultur sei auf das Teilen von Dingen und Inhalten ausgerichtet, unser Urheberrecht hingegen darauf, genau das zu verhindern.
Das Manifest endet mit der Aufforderung, netter zueinander und anderen ein gutes Beispiel zu sein, „gute“ Unternehmen zu unterstützen, die das Netz wirklich verstehen, und anderen ihren Raum zu lassen. Die poetischen Schlusssätze lauten: „The gravity of connection is love. Long live the open Internet. Long may we have our Internet to love.“
Es ist sicher dem Format des Manifests geschuldet, dass am Ende sehr plakative Aussagen stehen. „Seid nett zueinander“ ist ein Ratschlag, für den man wohl kaum Schelte zu erwarten hat. Seine Stärken zeigt das Manifest aber vor allem dann, wenn es konkret wird. Wenn es zum Beispiel präzise aufzeigt, dass unsere kulturellen Praktiken ganz und gar nicht zu unserem Urheberrecht passen. Anderen Problemen weichen die Thesen aber leider aus. Das eigene Verhalten positiv auszurichten und dem Netz etwas Konstruktives beizusteuern ist sicher der erste Schritt, doch was ist mit den Grenzüberschreitungen um uns herum? Wie sollen wir uns zum Handeln Anderer in unserem digitalen Umfeld positionieren?
Es reicht nicht, bei einem Hassmob wie Gamergate nicht mitzumachen, man muss sich mit den Opfern solcher Übergriffe zu solidarisieren.
Der enge Fokus auf das Individuum und seine nur sich selbst betreffenden Verpflichtungen widerspricht dem Charakter des Netzes als sozialer Raum, als Lebenswelt miteinander verbundener Menschen. Wie im Offline-Leben müssen wir nicht nur unser eigenes Handeln reflektieren sondern uns auch gegenseitig Schutz und Stütze sein. Es reicht nicht, bei einem Hassmob wie Gamergate nicht mitzumachen, sondern es muss der Anspruch an die Mitglieder einer Gemeinschaft sein, sich mit den Opfern solcher Übergriffe zu solidarisieren. Das heißt: explizit Übergriffe zu sanktionieren und Übergreifende zu kritisieren.
Fazit
Was bleibt also übrig vom „New Clues“-Manifest? Wird es eine ähnliche Wirkung entfalten können, wie das erste „Cluetrain Manifesto“ seinerzeit? Ich bin skeptisch.
Weinberger und Searls bringen viele Erkenntnisse aus den letzten Jahren unterhaltsam, treffend und präzise auf den Punkt. Das Netz ist ein Aspekt der realen Welt und außerdem ein sozialer Raum, dessen Betrachtung schon viel zu lange durch die rein technische Brille gefiltert wurde. Unser Urheberrecht ist fundamental kaputt und weitgehend inkompatibel mit dem Netz. Auch der Trade-Off Überwachung/Sicherheit vs. Privatsphäre und die Konzeptualisierung des Begriffs Privatsphäre selbst müssen unter dem Eindruck einer digital vernetzten Gesellschaft neu gedacht werden. Werbung ist kaputt und wird eher noch kaputter durch Native Advertising und fehlgeleitete Versuche, sie zu personalisieren.
Am Ende bleibt ein Dokument mit einigen tollen Formulierungen, dass aber leider in der Denkwelt der Neunzigerjahre gefangen ist.
Leider machen es sich die Autoren insgesamt etwas zu einfach und versuchen schwierigen Fragen auszuweichen. Sie ignorieren den Stand von Debatten um die Durchsetzung sozialer Normen, die in den letzten Jahren und Monaten weit vorangeschritten sind. Und sie scheitern teilweise daran, über ihren eigenen Tellerrand hinauszublicken.
Das Netz ist ein sozialer Raum, das ist richtig. Aber es ohne seine physikalischen Aspekte zu denken und Staaten auszublenden, funktioniert heute nicht mehr. Staaten greifen mit Macht ins Netz ein, blockieren, leiten um, speichern, lesen mit. Das bringt Gefahren mit sich, wie das vielzitierte Schengen-Routing oder die Möglichkeit von Zensur. Andererseits können wir der Frage, wie das Netz reguliert werden, wie unsere Gesetze und Normen durchgesetzt werden sollen, wie die Interessen und die zunehmende Macht transnationaler Konzerne gegenüber dem Einzelnen ausgeglichen werden sollen, nicht mehr aus dem Weg gehen. All die neuen Startups, die die Welt zu revolutionieren versprechen (zumindest ihren Investoren gegenüber), basieren auf dem Verständnis, dass die digitale und die analoge Welt nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden können: Airbnb und Uber sind nur zwei Beispiele. Die Probleme der kommenden Jahre werden sich nicht mehr auf Daten beziehen sondern auch ganz direkt auf die analoge Welt. Das Internet ist genauso analog wie es digital ist.
Es ist durchaus richtig, die Wichtigkeit des Links und die Gefahr von Silos wie Facebook zu betonen. Trotzdem ist es falsch, dabei die Frage außer acht zu lassen, welchen technischen und konzeptionellen Aufwand man der Mehrheit der Bevölkerung abverlangen kann und darf. Plattformanbieter stellen vielen Menschen die Werkzeuge zur Beteiligung bereit, genau wie es die Utopie von Weinberger und Searls verspricht. Hier wäre eine nuanciertere Betrachtung der Rolle von Plattformanbietern wichtig gewesen: Welche Forderungen muss man an Dienstanbieter wie Facebook richten, um ihren Usern eine bewusste und faire Nutzung zu ermöglichen?
Das größte Manko des Manifests sehe ich allerdings darin, die Verantwortung von Menschen nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr Umfeld und sein Handeln auszublenden. Das Internet wird als sozialer Raum aufgefasst, die Individuen, die sich in ihm bewegen, bleiben allerdings seltsam isoliert. Die Debatten der letzen Monate und Jahre um Inklusion, Diversität in der Tech-Branche, Verhaltensregeln auf Konferenzen und Antidiskriminierung scheinen an den Autoren weitgehend vorbeigegangen zu sein.
So bleibt am Ende ein Dokument mit einigen tollen Formulierungen und Zustandsbeschreibungen, dass aber leider zu sehr in der Denkwelt der Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts gefangen ist. Auch wenn Weinberger und Searls einen anschlussfähigen Startpunkt für eine größer angelegte Diskussion um digitale Normen vorgelegt haben. Immerhin steht das „New Clues“-Manifest unter freier Lizenz zur Bearbeitung bereit — damit das Internet das tun kann, was es am besten kann: sich eines Inhalts bemächtigen, ihn remixen und kollaborativ aufpolieren.